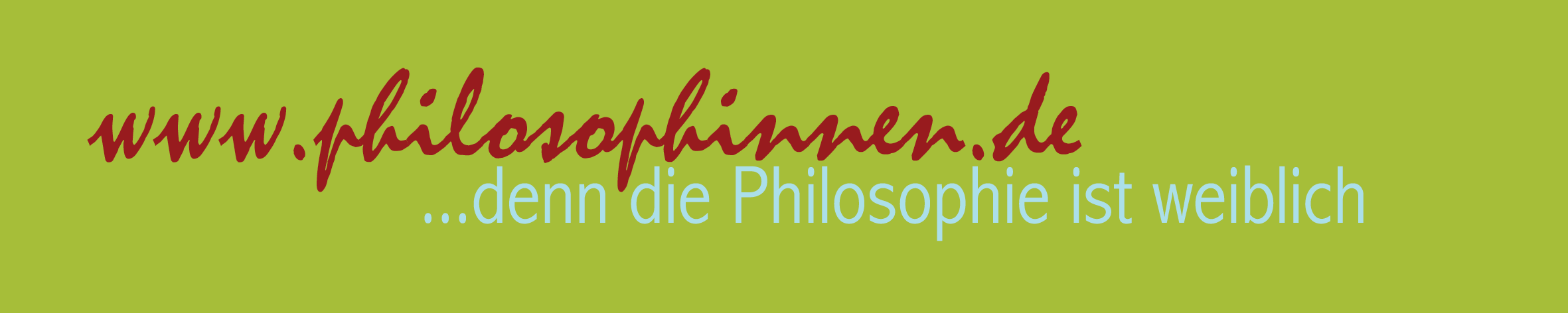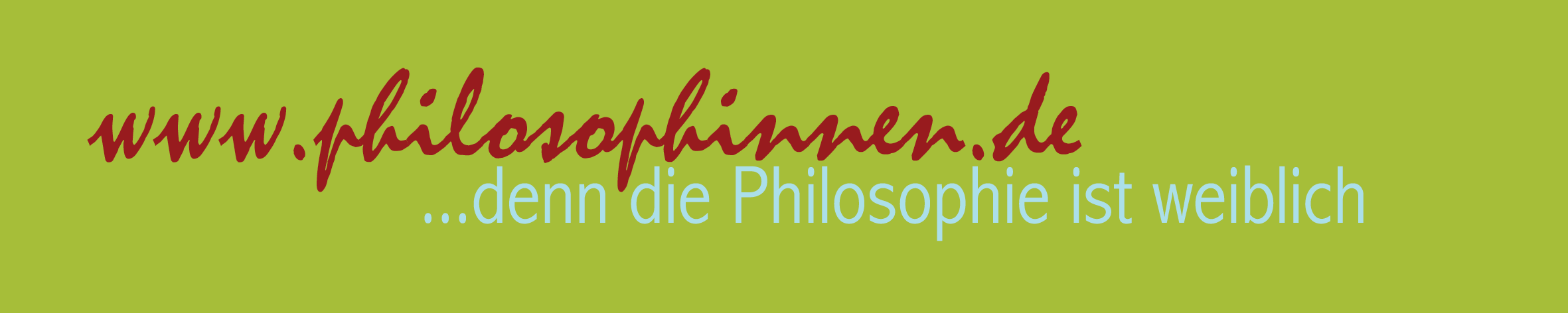|
Lexikon
Zeittafel
Themen
|
Philosophin
des Monats Februar
Laura Bassi

Eine
Frau, Professorin an einer Universität, heute ganz normal, im 18.
Jahrhundert grenzte das an ein Weltwunder. Und so hat Laura Bassi
wahrscheinlich auch auf viele gewirkt, Männer und Frauen.
Eine außergewöhnliche Begabung war sie auf jeden Fall,
als Philosophin und als Naturwissenschaftlerin. Zeitgenossen sagten von
ihr, sie sei mit einer Seele und einem Geist ausgestattet, der
weit über dem normaler Sterblicher lag.
Bevor
sie sich der Physik zuwandte, hat Bassi mit der Verteidigung
ihrer 49 Thesen von sich reden gemacht. Diese Thesen zur Metaphysik,
zur Physik und zum Menschen verteidigte sie vor einem
wissenschaftlichen Gremium und erhielt dafür die Anerkennung der
gelehrten Welt. Sie bezieht sich inhaltlich vor allem auf Aristoteles,
und Rene Descartes, den sie aber auch kritisiert hat.
Leseprobe aus Ursula I. Meyer: Aufklärerinnen, Aachen 2009, S. 175ff
Eine
Ausnahmefrau und Vorbild der besonderen Art war die Philosophin und
Naturwissenschaftlerin Laura Bassi (*1711, †1778). Sie wurde
1732 zur Professorin an der Universität in Bologna ernannt. Doch
diese Anerkennung war auch hart erarbeitet und verdient. Logik,
Metaphysik und Naturphilosophie waren ihre Themen und wie gut sie sich
darin auskannte, zeigte sich, als sie im Alter von 21 Jahren an einer
öffentlichen Diskussion über Philosophie teilnahm. Anwesend
waren gelehrte Männer aus Bologna, wie Kardinal Grimaldi und
Kardinal Erzbischof Lambertini, der spätere Papst Benedikt XIV. So
sah sich die junge Frau fünf der gelehrtesten Männer ihrer
Zeit gegenüber. Doch sie war ihnen völlig ebenbürtig und
ihre Argumente brachten ihr viel Bewunderung ein, auch von Lambertini.
Vor ihnen verteidigte sie von ihr aufgestellte Thesen gegen kritische
Einwürfe. Diese Philosophica studia bestehen aus 49 Thesen zur
Logik, zur Metaphysik (Sein/Ursachen/Gott/Engel), zur Physik
(Materie/Bewegung/Naturerscheinungen auf der Erde) und zum Menschen.
Ihre metaphysischen Thesen sind wesentlich von Aristoteles beeinflusst.
Erkenntnistheoretisch knüpft Bassi aber auch an Descartes an. In
den naturphilosophischen Teil über die Materie in physikalischer,
chemischer und biologischer Hinsicht, die Bewegung und die Gravitation
gehen auch Newtons Auffassungen ein. Die Physiologie des Menschen sowie
die Funktion seiner Sinnesorgane versucht Bassi mechanistisch zu
erklären. Trotzdem lehnt sie die cartesianische Trennung von Leib
und Seele ab.
Kurz nach dieser Diskussion trat sie als Kandidatin für das
Doktorat an der Universität in Bologna zur Prüfung an. Auch
hier machte sie einen so guten Eindruck, dass man ihr schließlich
einen Lehrstuhl anbot. So nahm Bassi als Professorin ihre
Lehrtätigkeit an der Universität auf. In ihrem Spezialgebiet,
der Experimentalphysik, galt sie als Kapazität. Ihre Lesungen
wurden mit Aufmerksamkeit verfolgt und sie hatte Studenten aus allen
Teilen Europas, vor allem bei griechischen, deutschen und polnischen
Studenten war sie beliebt. Sie stand im ständigen Briefwechsel mit
den berühmtesten europäischen Wissenschaftlern ihrer Zeit.
Dass sie in akademischen Kreisen hohes Ansehen genoss und über
einen bedeutenden Einfluss verfügte, wird z.B. an Voltaires
Anfrage deutlich, mit der er sich für ihre Aufnahme in die
renommierte Accademia delle Scienze di Bologna einsetzte und diese auch
erreichte.
Bassi wurde von allen bewundert und man verglich sie mit der antiken
Arete, von der es heißt, sie sei mit einer Seele und einem Geist
ausgestattet gewesen, der weit über dem normaler Sterblicher lag.
Die Ehrung und Vergöttlichung, die viele gelehrte Frauen erfahren
haben, ist allerdings auch eine Möglichkeit, die ganz
»normalen« Frauen herabzusetzen. Denn wenn gelehrte Frauen
wie Bassi einen Touch des Überirdischen hatten, konnte man alle
anderen Frauen weiterhin als dumm und unvernünftig hinstellen.
Mit ihrer Arbeit stellte Bassi die Männer in den Schatten, doch
sie übernahm außerdem die typische Frauenrolle. Sie war auch
ausgesprochen religiös, versuchte den Armen zu helfen und brachte
acht Kinder (andere Quellen sagen 12) zur Welt. Und was für die
gelehrte Männerwelt besonders wichtig war, sie ließ es nie
zu, dass ihre wissenschaftliche Arbeit dazu führte, dass sie ihre
häuslichen Pflichten vernachlässigte. So entkräftete sie
die meisten Vorurteile, die gelehrten Frauen gegenüber vorgebracht
wurden. Sie war aber auch ein Vorbild für andere Frauen, denn sie
zeigte, dass sich höhere Bildung und klassische weibliche Aufgaben
durchaus kombinieren ließen.
1755 gründete Bassi eine Schule für Experimentalphysik,
an der nicht nur junge Leute studierten, sondern auch andere
Naturwissenschaftler, wie der Biologe Spallanzani (er hat nachgewiesen,
dass in abgekochtem und vor Berührung mit atmosphärischer
Luft geschütztem Wasser keine Mikroorganismen entstehen) und der
Physiker Volta (ihm gelangen bahnbrechende Arbeiten auf dem Gebiet der
Elektrizität sowie die Konstruktion verschiedener elektrischer
Geräte).
Bassi wurde vor allem durch ihre Arbeiten über Mechanik bekannt.
Aufgrund deren wurde sie in die Akademie von Bologna aufgenommen. Sie
musste wie alle Mitglieder jährlich eine Forschungsarbeit
vorlegen: Über den Luftdruck 1746, Über Luftblasen in frei
fließenden Gewässern, 1747, Über Luftblasen, die aus
Flüssigkeiten aufsteigen, 1748. Außerdem erhielt sie ein
kleines Stipendium. Um ihre Forschungen durchführen zu
können, entwickelte sie Vorrichtungen für ihre Experimente
mit elektrischen Phänomenen. 1776 übernahm sie den Lehrstuhl
für Physik.
Von der wissenschaftsgeschichtlichen Forschung wird die Leistung Bassis
immer noch in Frage gestellt. Es wurde sogar in einer modernen
Veröffentlichung angezweifelt, ob sie wirklich gelehrt habe. Die
Tatsache, dass sie die wissenschaftliche Gemeinschaft mit ihren
Vorlesungen in Experimentalphysik, die sie dreißig Jahre lang
abhielt, immer wieder in Erstaunen versetzte, zählt nicht. Obwohl
die Veranstaltungen in ihrem eigenen Wohnzimmer statt fanden, waren sie
doch offizieller Natur und sie wurde dafür bezahlt. Und die
Vermischung von universitärer Arbeit und privatem Rahmen war ja
damals durchaus üblich. Anscheinend ist aber eine solche Frau
für Autoren noch heute eine so große Gefährdung ihrer
männlichen Überlegenheit, dass sie sie noch immer nicht
anerkennen können.hat.
|
Philosophie
weiter
lesen
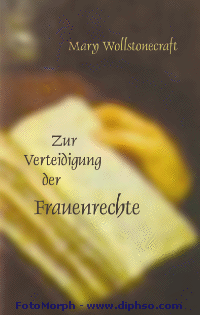
ein-FACH-verlag
www.ein-fach-verlag.de
|